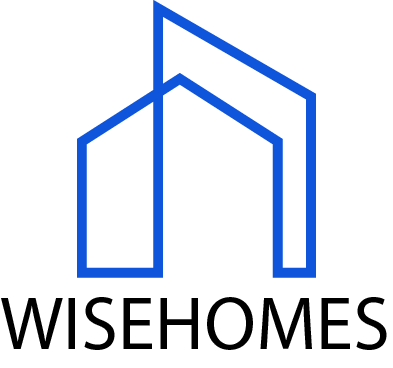Heiße Sommer, kühle Köpfe: Die thermische Bauteilaktivierung (TBA) nutzt Betondecken als große, unsichtbare Heiz- und Kühlflächen. Die Technik sitzt im Beton, arbeitet flächig und leise, erzeugt zugfreie Behaglichkeit und hält Fassaden frei von Splitgeräten. So bleiben Räume architektonisch klar, während die Temperaturen stabil und angenehm sind. Gleichzeitig sinken die Betriebskosten messbar, weil niedrige Vorlauftemperaturen genügen. Wer neu baut, setzt auf integrierte Systeme, die Komfort, Effizienz und Zukunftssicherheit verbinden – ohne sichtbare Technik im Raum.
So funktioniert die thermische Bauteilaktivierung
Das Prinzip ist einfach und robust: In die Betondecke werden Rohrleitungen eingelegt, durch die je nach Jahreszeit warmes oder kühles Wasser fließt. Die massive Decke wird so zur großflächigen Heiz- oder Kühlfläche und übernimmt Speicherfunktion. Im Winter gibt die aktivierte Masse Energie gleichmäßig an den Raum ab, im Sommer nimmt sie überschüssige Wärme auf; die Temperatur bleibt dadurch stabil. Eine Anlage mit thermischer Bauteilaktivierung vereint Heizen und Kühlen in einer Lösung und harmoniert ideal mit Erdwärme, Solarenergie oder effizienten Wärmepumpen.
Das Ergebnis: ganzjährig ein angenehmes Raumklima. Es entsteht keine Zugluft und es fehlen störende Geräusche. Komfort fühlt sich damit natürlich und ruhig an, während die Räume optisch frei bleiben und Möbel flexibel platziert werden können.
Komfort entsteht leise, flächig und zugfrei.
Darum boomt TBA im Wohnbau 2025 in Österreich
Die Nachfrage wächst aus mehreren Gründen. Erstens werden die Sommer spürbar heißer, weshalb effiziente und leise Kühlung erforderlich ist. Zweitens greifen strengere Vorgaben für klimaschädliche Kältemittel. Systeme mit niedrigen Vorlauftemperaturen passen optimal zu Wärmepumpen, die unter diesen Bedingungen besonders effizient laufen. Zudem lässt sich Photovoltaik einbinden: Aus Solarstrom gewonnene Wärme oder Kälte kann in der aktivierten Betondecke zwischengespeichert werden. So sinkt der Bedarf an fossilen Energieträgern – und die Betriebskosten bleiben dauerhaft niedriger.
Konkrete Vorteile für Bauherr:innen und Käufer
Die Betriebskosten sind niedrig: In Projekten aus dem mehrgeschossigen Wohnbau weisen wissenschaftlich begleitete Messungen lediglich rund 2 bis 3 Euro pro Quadratmeter und Jahr für Heizen und Kühlen aus – deutlich weniger als bei herkömmlichen Systemen. Gleichzeitig überzeugt der Komfort: Es gibt keine Zugluft und keine Geräusche, denn große Flächen verteilen Temperaturen gleichmäßig und sanft. Zugleich gewinnen Sie gestalterische Freiheit, weil weder Heizkörper noch Außengeräte die Architektur stören. Wer Details prüfen möchte, findet weitere Informationen in der neutralen Kontaktübersicht.
Worauf Sie bei TBA achten sollten
Entscheidend ist der Zeitpunkt: Planen Sie die thermische Bauteilaktivierung früh, idealerweise bereits in der Entwurfsphase. Das System beeinflusst Statik, Deckenaufbau, Hydraulik und die gesamte Gebäuderegelung. Wer erst nach dem Rohbau darüber nachdenkt, verliert Planungsspielraum. Daher sollten Planer:innen und Bauherr:innen von Beginn an vier Punkte abstimmen: ausreichende Deckenstärke für Speicherwirkung, eine statisch abgestimmte Rohrleitungsführung, eine intelligente Regelungstechnik für effizienten Betrieb sowie die saubere Integration mit Wärmepumpe, Photovoltaik und weiterer Haustechnik.
Investition mit Weitblick und Planungssicherheit
Mehrkosten nahe guter Fußbodenheizung; im Mehrfamilienbau oft günstiger.
-
Frühe Planung entscheidet
Planen Sie TBA bereits im Entwurf. Dadurch vermeiden Sie Kollisionen und sichern Termine.
- Statik früh einbinden und prüfen.
- Deckenaufbau und Masse früh und gezielt festlegen.
- Rohrführungen mit Tragwerksplanung koordinieren, damit Lasten, Dübel und Öffnungen sicher bleiben.
-
Technik und Regelung richtig abstimmen
Regelung prägt Effizienz und Komfort. Planen Sie sauber.
- Niedrige Vorlauftemperaturen konsequent nutzen und dokumentieren.
- Trägheit der Decke berücksichtigen; vorausschauend regeln statt ständig takten.
- Mit Wärmepumpe, PV und Speichern Strategien für Sommer und Winter festlegen.
-
Integration im Neubau sichern
Nachrüsten ist praktisch unmöglich. Entscheiden Sie im Neubau.
- Gewerkekoordination früh definieren und kommunizieren.
- Schnittstellen zu Lüftung, Sanitär und Elektro sauber planen.
- Dokumentation, Hydraulikplan und Prüfungen vor dem Betonieren fixieren.
Zahlen und Beispiele aus Österreich
- In Wien und im Burgenland ist TBA besonders verbreitet; dort hat sich die Technik im Wohnbau etabliert.
- Förderdaten 2021–2023: 65 Prozent der Anträge aus Wien, rund 10 Prozent aus dem Burgenland; TBA kommt dort öfter zum Einsatz.
- Erstes Sozialbau-Projekt: Die Wohnhausanlage MGG22 in Wien-Donaustadt mit 155 Wohnungen ist seit 2019 in Betrieb.
- Auf der Innovationslandkarte sind über 120 Gebäude in vier Ländern verzeichnet; die Liste wächst kontinuierlich.
- Davon entfallen rund 70 Projekte auf Österreich insgesamt; der Großteil liegt im urbanen Raum.
- Rund 1.600 Neubauwohnungen nutzen die Technologie bereits und profitieren von flächigem Heizen und Kühlen im Alltag.
- In Summe werden fast 190.000 Quadratmeter Wohnfläche über aktivierte Bauteile temperiert; das erhöht Komfort und Effizienz dauerhaft.
- TBA vereint Heizen und Kühlen in einem System und passt hervorragend zu Wärmepumpen sowie Photovoltaik im zeitgemäßen Wohnbau.
Fazit
Thermische Bauteilaktivierung ist keine Zukunftsmusik, sondern eine bewährte Lösung für den Neubau. Wer darauf verzichtet, vergibt Chancen bei Behaglichkeit, Effizienz und Betriebskosten. Die Technik minimiert F‑Gas‑Risiken, vermeidet sichtbare Splitgeräte an Fassaden und senkt Lastspitzen im Stromnetz. Besonders in Wien und den östlichen Bundesländern zeigt die Praxis, dass flächiges Heizen und Kühlen leise funktioniert und Planungsziele zuverlässig erreicht werden.
Quellen: solidbau.at, beton-dialog.at, a3bau.at, handwerkundbau.at, zement.at – vertiefende Beiträge zu Technik, Kosten, Planung und Praxis; redaktionelle Auswahl, zuletzt geprüft und plausibilisiert.